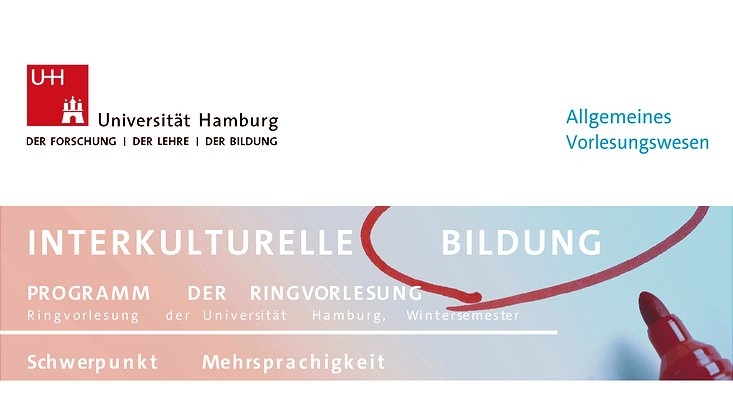Sprachliche Aufgabengestaltung und Kompetenzentwicklung: LiDS Mitglied Jan Retelsdorf stellt zwei neue Projekte vor
25. April 2025
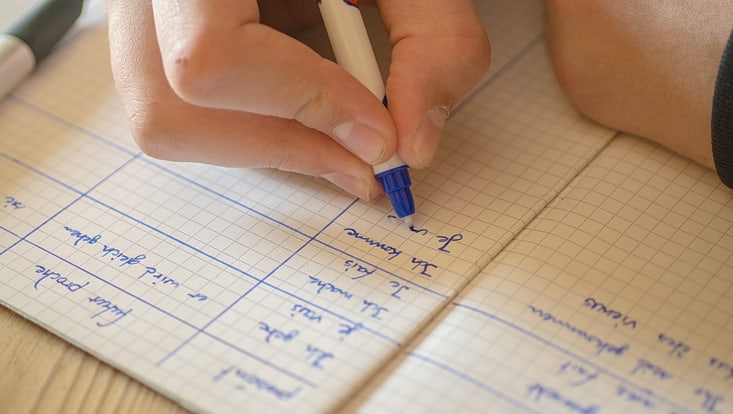
Foto: Image by Tim Hauswirth von Pixabay
LiDS Mitglied Jan Retelsdorf startet im April mit gleich zwei neuen Projekten!
Zusammen mit LiDS Mitglied Nadine Cruz Neri arbeitet er seit dem 1. April 2025 an dem Projekt „Teachers' assessment of linguistic difficulty of science tasks for students at risk (TAL)“ in Kooperation mit Hendrik Härtig von der Universität Duisburg-Essen und Sascha Bernholt vom IPN Kiel. In dem gemeinsamen Forschungsprojekt untersucht das Forschungsteam einen möglichen Zusammenhang zwischen der sprachlichen Gestaltung von Chemie- und Physikaufgaben und möglichen Verzerrungen bei der Beurteilung von Schüler:innen aus Risikogruppen durch Lehrende. Zwei Wochen später, am 15. April 2025, folgte direkt das nächste Projekt von Jan Retelsdorf. Das Forschungsteam bestehend aus Jan Retelsdorf und Nora Wendering von der Universität Hamburg sowie Britta Pohlmann und Markus Lücken vom IfBQ untersucht im Rahmen des Projekts „Kompetenzentwicklungen in der Primarstufe (KomPri)“ den Entwicklungsverlauf der Lese- und Mathematikkompetenzen von Grundschüler:innen.
Im Interview gewährt Jan Retelsdorf weitere Einblicke in die Forschungsprojekte und zeigt auf, welche zentrale Rolle Sprache spielt, vom Leseverstehen bis zum Physikunterricht.
In Ihrem neuen Projekt „Teachers' assessment of linguistic difficulty of science tasks for students at risk (TAL)“ untersuchen Sie die sprachliche Gestaltung von Aufgaben als einen potentiellen Einflussfaktor auf den Schwierigkeitsgrad von Aufgaben. Sie konzentrieren sich dabei insbesondere auf Chemie- und Physikaufgaben. Oft denkt man bei diesen Fächern eher an Formeln und Elemente. Warum könnte Sprache auch bei Aufgaben in diesen naturwissenschaftlichen Fächern eine Rolle spielen?
Sprache spielt natürlich in allen Fächern eine wichtige Rolle – sei es in der mündlichen Instruktion oder auch beim Lesen von Texten, digitalen Materialien oder beim Bearbeiten von Aufgaben. Auch in naturwissenschaftlichen Fächern ist das natürlich nicht anders. Wir wissen zudem, dass Texte und auch Aufgaben hier bestimmte sprachliche Gestaltungsmerkmale haben, die das Verstehen der fachlichen Inhalte möglicherweise erschweren. Dazu können etwa polyseme – also mehrdeutige – Wörter gehören oder die Verwendung von Nominalisierungen. Solche sprachlichen Merkmale sind durchaus häufig in Texten und Aufgaben der beiden genannten Fächer, in denen natürlich auch nicht sprachfrei mit ausschließlich Formeln oder grafischen Darstellungen gearbeitet wird.
Weshalb haben Sie sich entschieden, in Ihrem Forschungsprojekt besonders die Verknüpfung zwischen der sprachlichen Gestaltung von Aufgaben und die Beurteilung von Schüler:innen aus Risikogruppen zu untersuchen?
Wir wissen aus einer Vielzahl von groß angelegten Studien wie etwa dem IQB-Bildungstrend oder auch PISA, dass es eine substanzielle Anzahl an Schüler:innen gibt, die die Mindeststandards in den untersuchten Fächern, darunter auch Naturwissenschaften, regelmäßig nicht erreichen. Sprachliche Herausforderungen können sich in dieser Gruppe besonders nachteilig auswirken. Zudem gibt es Forschung, die zeigt, dass wir beim Beurteilen unsere Standards unbewusst anpassen, wenn Aufgaben besonders schwierig wirken, und negativ stereotypisierte Gruppen sogar positiver beurteilen. Es kann also passieren, dass Jugendliche der Risikogruppe bei sprachlich komplexen Aufgaben positiver bewertet werden als Jugendliche, die nicht dieser Gruppe angehören. Das kann pädagogisch sinnvoll sein, aber auch dazu führen, dass Schwächen übersehen werden und so Förder- oder Unterstützungsbedarf nicht erkannt wird. Herauszufinden, ob es zu solchen Verzerrungen bei der Beurteilung kommt, ist ein wesentliches Ziel des Projekts.
Welche Erkenntnisse für die schulische Praxis erhoffen Sie sich aus dem Projekt?
Es ist manchmal gar nicht so einfach, einen unmittelbaren Nutzen zu erkennen bei Forschung wie dieser, die irgendwo zwischen Grundlagen- und Anwendungsforschung angesiedelt ist. Zunächst einmal geht es uns darum das beschriebene Phänomen der Shifting Standards – so nennen wir das eben beschriebene unbewusste Anpassen der Beurteilungsmaßstäbe – besser zu verstehen, um mehr darüber zu erfahren, unter welchen Bedingungen es zu diesem Phänomen kommt. Bei uns im Projekt sind wir dabei speziell daran interessiert, ob die sprachliche Gestaltung von Aufgaben dabei Auswirkungen auf die angelegten Beurteilungsmaßstäbe hat. Langfristig können unsere Ergebnisse dann einen Teil dazu beitragen, Urteile von Lehrer:innen zu verbessern und dabei – wenn wir entsprechende Befunde erzielen - auch für die Rolle sprachlicher Merkmale von Aufgaben in diesem Zusammenhang zu sensibilisieren.
In Ihrem zweiten Projekt „Kompetenzentwicklungen in der Primarstufe (KomPri)“ beschäftigen Sie sich mit der Kompetenzentwicklung in der Primarstufe und untersuchen die Bildungsverläufe und -bedingungen, die zum Erreichen der Bildungsstandards führen. Könnte Sprache hier ebenfalls eine relevante Rolle spielen?
Ja, natürlich. Sprache ist ja mit Humboldt gesprochen der Schlüssel zur Welt und natürlich auch eine wesentliche Voraussetzung von Bildungserfolg. Daher interessieren wir uns im Projekt KomPri neben der Entwicklung mathematischer Kompetenzen auch für die Entwicklung der Lesekompetenz sowie als Voraussetzung dieser Entwicklungen für den vorschulischen Sprachstand der Schüler:innen, der in Hamburg flächendeckend in der Viereinhalbjährigenvorstellung erfasst wird.
In Ihren beiden neuen Projekten richten Sie den Fokus auf Schüler*innen aus Risikogruppen, die z.B. die Bildungsstandards in der Primarstufe nicht erreichen. In „KomPri“ möchten sie dafür u.a. die Wirksamkeit von Unterstützungsleistungen und Bildungsbeteiligung in den Blick nehmen. Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich für solche Unterstützungsleistungen?
Eine Hoffnung, die wir vor allem mit KomPri verbinden, ist es mehr darüber zu erfahren, welche Unterstützungsmaßnahmen vielleicht für welche Gruppen von Schüler:innen besonders hilfreich sind, um perspektivisch noch zielgerichteter maßgeschneidert intervenieren und fördern zu können.
Das Interview wurde von LiDS Koordinatorin Larissa Cosyns geführt.