Schule, Migration und WiderstandDekoloniale Perspektiven auf Lehrer:innenbildungEin Interview mit Sidney Oliveira
4. Juli 2025, von Muna Cherkaoui
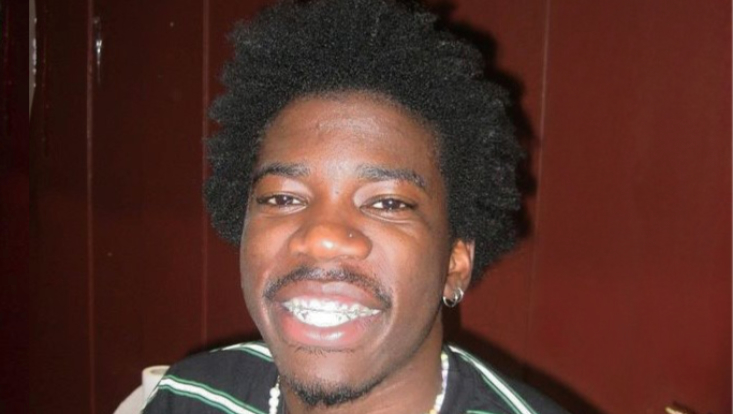
Foto: Privat
Wie lässt sich Schule in einer vielfältigen Gesellschaft neu denken? Welche Rolle spielen postmigrantische und postkoloniale Perspektiven in der Lehrer:innenbildung? Und auf welche Hürden stoßen rassifizierte Studierende eigentlich? Darüber sprechen wir mit Sidney Oliveira, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg und engagiertes Mitglied im Netzwerk „Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“.
Ihr aktuelles Seminar heißt „Schule und Postmigration“. Wie würden Sie die Begriffe Postmigration und Postkolonialismus in einfachen Worten erklären?
Postmigrantische Diskurse haben sich von postkolonialen Theorien inspirieren lassen. Der Begriff „post-“ wirkt ein bisschen trügerisch – etymologisch bedeutet er zwar „nach“, aber es geht nicht nur um das, was nach dem Kolonialismus kam, sondern vielmehr um die fortwirkenden Effekte kolonialer Machtverhältnisse. Postkolonialismus fragt also: Welche kolonial geprägten Menschenbilder, Denkmuster und Machtstrukturen wirken bis heute fort – im Alltag, in gesellschaftlichen Strukturen, in Bildung?
Postmigrantische Perspektiven knüpfen hier an, richten den Fokus aber auf den deutschen Kontext. Hier geht es etwa darum, welche hegemoniale Konstruktionen von „Deutschsein“ existieren und wer das eigentlich definiert. In Bezug auf Schule kann sich ein eng gefasster Begriff von „Deutschsein“ beispielsweise darin äußern, dass die Erstsprachen von Schüler:innen nicht wertgeschätzt werden. Untersucht werden Prozesse der Ein- und Ausschließung, der Markierung und Abwertung sowie ihre Verflechtung mit hegemonialen Macht- und Wissensordnungen.
In der Seminarbeschreibung ist von Begegnungen mit Aktivist:innen, Lehrkräften und Diversity-AGs die Rede. Wie sahen diese Begegnungen konkret aus – und gab es Momente oder Aussagen, die für Sie besonders prägend bzw. inspirierend waren?
Bisher hatten wir Besuch von einer sogenannten Diversity-AG vom Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium – wobei man sie eher als Anti-Rassismus-AG bezeichnen könnte. Die Gruppe besteht aus Schüler:innen der Sekundarstufe I und II, die sich aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzen. Besonders schön war zu sehen, wie die Lehramtsstudierenden dadurch erstmals in direkten Austausch mit Schüler:innen kamen. Inhaltlich haben wir uns in dieser Sitzung vor allem mit dem Begriff der Handlungsfähigkeit beschäftigt. Gerade als Schüler:innengruppe, die sich gegen Rassismus engagiert, stößt man da schnell auf bestehende Machtverhältnisse zwischen Lehrkräften und Schüler:innen sowie systemische Barrieren. Daraus ergab sich die zentrale Frage: Kann man innerhalb des bestehenden Schulsystems wirklich etwas verändern – oder müsste man Schule nicht grundsätzlich neu denken?
Viele Lehramtsstudierende mit Migrationsgeschichte stoßen im Studium auf besondere Herausforderungen. Welche Hürden treten dabei häufig auf – etwa im Hinblick auf Zugehörigkeit, Erwartungshaltungen oder den Zugang zu bestimmten Angeboten?
Universitäten sind nach wie vor sehr weiße Räume – auch unsere hat eine koloniale Geschichte, die aufgearbeitet werden muss. In Deutschland gab es keine nachhaltige Dekolonisierung, stattdessen sind koloniale Spuren bis heute sichtbar: in Lehrinhalten, Namen oder auch in der Architektur. Auch „Erziehung“ und „Bildung“ sind aus historischer Sicht Begriffe, mit denen kolonialrassistische Ideologien legitimiert wurden. Für rassifizierte Studierende ist Universität also kein neutraler Raum – er ist ausgrenzend oder sogar gewaltvoll. Demzufolge bedeutet das, dass nicht jeder mit den gleichen Lernvoraussetzungen startet.
Hinzu kommt, dass viele migrantisierte Lehramtsstudierende auch Erstakademiker:innen sind. Sie haben oft wenig finanzielle oder fachliche Unterstützung im familiären Umfeld, müssen neben dem Studium arbeiten und starten mit ganz anderen Voraussetzungen ins Studium als viele ihrer Kommiliton:innen. Gleichzeitig fehlt es oft an Repräsentation: An vielen Fakultäten fehlen Schwarze Wissenschaftler:innen und Wissenschaftler:innen of Color – ein Zustand, der institutionelle Ausschlussmechanismen stabilisiert und nicht-weiße Wissenspositionen marginalisiert. Dazu kommt eine Form epistemischer Gewalt, die über die Curricula wirkt: Wissen wird häufig normativ vermittelt, dominiert von weißen, meist männlichen Perspektiven. Wissen, das außerhalb Europas entstanden ist, findet kaum Beachtung.
Das alles macht deutlich, wie tief diese Ausschlüsse im System verankert sind. Für eine wirkliche Veränderung müssten wir Universität grundlegend umdenken. Für’s Erste hilft es aber schon, Räume zu schaffen, in denen rassifizierte oder migrantisierte Studierende über ihre Erfahrungen sprechen und sich empowern können. Das alles gilt im Grunde auch für Schulen. Da braucht es vor allem eine rassismuskritische Lehrkräfteausbildung, für die ich mich im Rahmen dieses Seminars auch einsetze.
Abschließend eine persönliche Frage: Hat sich Ihre eigene Sicht auf Schule und Migration durch Ihre wissenschaftliche Arbeit verändert? Was war Ihre Motivation, sich genau in diesem Themenfeld zu engagieren?
Ja, auf jeden Fall – meine Sicht auf Schule und Migration hat sich durch meine wissenschaftliche Arbeit enorm verändert. Gerade in machtkritischen Kontexten kann es sich anfangs fast entmutigend anfühlen – als hätte man keine Handlungsmöglichkeiten. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass bestimmte Situationen, die im Bildungsalltag passieren, nicht unbedingt die Schuld einzelner Lehrkräfte oder Lehrender sind. Oft wird Verantwortung individualisiert – dabei liegen viele der Probleme strukturell verankert im System.
Was meine Motivation betrifft, kann ich meine eigene Perspektive als Schwarze Person, die in Deutschland sozialisiert wurde, nicht aus meiner Forschung ausklammern. Neben meinem Dissertationsprojekt möchte ich herausfinden, wie Schwarze Schüler:innen das Bildungssystem in Deutschland wahrnehmen, welche Erfahrungen sie machen – dazu gibt es aktuell kaum Studien. In den USA gibt es zum Beispiel race als soziale Kategorie. In Deutschland gibt es das aus verschiedenen Gründen nicht – das zu erklären würde ein neues Fass aufmachen. Hier haben wir in erster Linie die Kategorie „Migrationshintergrund“, die aber vor allem aus der Integrationsforschung kommt und für die Analyse von Diskriminierungskontexten nur bedingt taugt. Das bedeutet, dass viele Schwarze Menschen, die in Deutschland leben nicht erfasst, ihre Perspektiven nicht gehört werden. Da gibt es also Forschungslücken. In den Interviews mit Schwarzen Schüler:innen merke ich oft, wie sehr mich das auch persönlich betrifft, weil ich an meine eigene Schulzeit erinnert werde. Und genau daraus entsteht meine Motivation: Ich wünsche mir nicht die Illusion einer rassismusfreien Schule, sondern eine pädagogische Praxis, die rassismuskritisch handelt, solidarisch interveniert und institutionelle Verantwortung übernimmt – damit rassifizierte Schüler:innen in ihrem Wissen, ihren Perspektiven und ihrer Würde ernst genommen werden, da Rassismus als Struktur nicht einfach abgeschafft werden kann. Mein Engagement ist daher nicht nur wissenschaftlich, sondern auch aktivistisch und widerständig.
Das Interview wurde von Muna Cherkaoui geführt.


