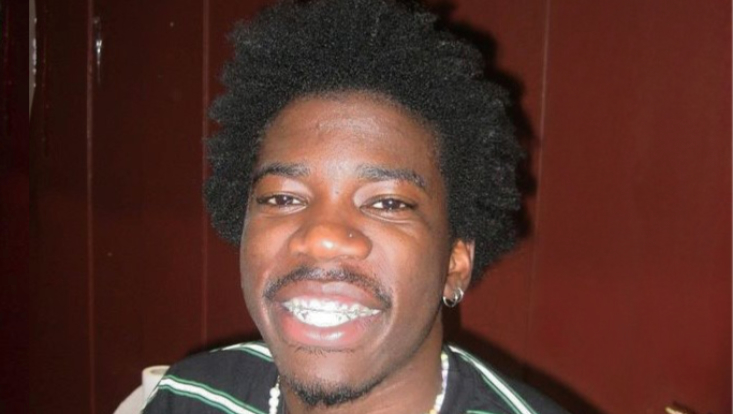Wie kann KI in der Pflegeberatung unterstützen?„Beratungsstellen müssen dafür sensibilisiert werden, dass Ratsuchende sich mittels generativer KI informieren.”Interview mit Kristin Skowranek aus dem Projekt „KI in der Pflegeberatung”
25. August 2025

Foto: Essert
Wie kann generative KI in der Pflegeberatung helfen? Kann sie Übersetzungen übernehmen, Anträge ausfüllen oder Formulare in leichter Sprache ausdrücken? Und was muss dabei beachtet werden? Diesen Fragen geht das Team des im Rahmen des DATIpilot Innovationssprint des BMFTR geförderten Projekts „KIP: KI in der Pflegeberatung – Einsatzmöglichkeiten von generativen KI-Tools in Beratungssettings“ nach. Kristin Skowranek ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Erwachsenenbildung und Lebenslanges Lernen der Fakultät für Erziehungswissenschaft und leitet aktuell das Projekt „KI in der Pflegeberatung”. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wer von generativer KI in der Pflegeberatung profitieren kann und wo die KI an ihre Grenzen stößt.
Liebe Frau Skowranek, Sie forschen aktuell unter anderem zu KI in der Pflegeberatung sowie im Kontext der Alphabetisierung. Welche Fragen stehen aktuell im Fokus Ihres wissenschaftlichen Arbeitens?
Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam mit der Hamburger Volkshochschule generative KI in Kursen der Grundbildung und Alphabetisierung erprobt. Im Rahmen dieses Projekts haben wir beobachtet, dass man mit generativer KI unheimlich viel machen kann – man kann ihr gezielt Fragen stellen oder sich ganz normal mit ihr unterhalten. Wir haben uns gefragt: Könnte die KI auch beraten? Und wo liegen Potenziale generativer KI in Beratungskontexten? Noch vor meinem Studium habe ich eine Ausbildung zur Pflegeberatung gemacht. Von dem Themenbereich wusste ich also, dass ich die Ergebnisse der KI in jedem Fall richtig einordnen kann. Daraus entstand unser aktuelles Projekt „KIP: KI in der Pflegeberatung – Einsatzmöglichkeiten von generativen KI-Tools in Beratungssettings“.
Ganz konkrete Fragen, mit denen wir uns im Moment beschäftigen sind: Wie kann KI im Beratungskontext genutzt werden? Sind die Fragenden zufrieden mit den Antworten oder wirft die KI neue Fragen auf? Sind die Ratsuchenden in der Lage, Prompts, also Eingaben in die KI, so zu formulieren, dass sie zu den benötigten Ergebnissen führen?
Ziel Ihres Projektes „KI in der Pflegeberatung“ ist die Übertragung des ko-kreativen Literacy Promptathon-Konzepts auf die Pflegeberatung. Was hat es damit auf sich?
Anfang 2023 hat Tilo Böhmann, Leiter der Forschungsgruppe ITMC (IT-Managment und Consulting) am Fachbereich Informatik und Vizepräsident der Uni Hamburg, den ersten Prompt-a-thon® an der Uni Hamburg durchgeführt. Wir waren mit dem Arbeitsbereich Erwachsenenbildung und Lebenslanges Lernen vor Ort. Nach der Veranstaltung waren wir uns einig, dass man unbedingt prüfen sollte, ob das mit und für Menschen nutzbar ist, die Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben haben. In dem Bereich begegnet man oft Menschen, für die die Nutzung digitaler Endgeräte nicht unbedingt selbstverständlich ist – gerade aufgrund ihrer Lese- und Schreibschwierigkeiten. Unsere Fragestellung zielte darauf ab, ob und wie generative KI Menschen mit geringer Literalität eine gewisse Teilhabe im Alltag mit ermöglichen kann. So entstand unser Literacy Promptathon.
In einem ersten internen Workshop haben wir einen Literacy Promptathon zu diesem Thema mit Erwachsenenbildner:innen aus der Praxis ausprobiert und auf Basis der Ergebnisse das Konzept angepasst. Weitere Workshops gab es anlässlich des Weltalphabetisierungstages 2023 mit Betroffenen und Lehrenden aus der Grundbildung und Alphabetisierung. Außerdem haben wir das Konzept in Grundbildungs- und Alphabetisierungskursen sowie Müttersprachkursen der Hamburger Volkshochschule getestet.
Darauf aufbauend entwickelte sich mit Blick auf die Pflegeberatung die Frage: Was ist, wenn Menschen in die Beratung gehen, die nicht die deutsche Sprache sprechen? Oder die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben und dann mit ellenlangen Formularen und Behördentexten konfrontiert werden? Kann KI hier eine Übersetzungsleistung erbringen und bestimmte Dokumente zum Beispiel in einfacher Sprache erklären oder in eine andere Sprache übersetzen? So kam die Idee, das Workshop-Format auf Beratungssituationen zu übertragen.
Für wen ist KI in der Pflegeberatung noch wichtig und warum?
Generative KI in der Pflegeberatung kann Personen mit Sprachbarrieren oder Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben unterstützen. Eine weitere wichtige Rolle spielt der ländliche Raum. Die Beratungsstellen sind oft nur in größeren Orten einer Region. Zwischen dem eigenen Wohnort und der nächsten Beratungsstelle können auch mal 20-30 km liegen. Hinzu kommen die Öffnungszeiten: In Regionen mit einer eher geringen Bevölkerungsdichte beschränken sich die Beratungszeiten oft auf zwei bis drei Tage pro Woche und auf Zeiten von 9-12 Uhr oder 14-16 Uhr.
Was kann eine KI also für Erstberatung leisten? Im besten Fall muss eine Person, deren Angehörige pflegebedürftig werden oder die selbst kurzzeitig auf Hilfe angewiesen ist, mit ihrer Frage nicht sechs Tage warten. Die KI kann unterstützen, indem sie dieser Person ganz grundlegende Fragen vorab beantwortet. Welche Anlaufstelle außer meiner Beratungsstelle gibt es noch? Wer kann Hilfsmittelberatung leisten? Wo ist der nächste Pflegedienst und kann ich mich mit meinem Anliegen an den Pflegedienst wenden? Das sind wichtige Eckdaten für eine erste Orientierung.
Wie sieht der Forschungsprozess aus? Welche Methoden verwenden Sie?
Angefangen haben wir mit Expert:inneninterviews, um Erstbedarfe ratsuchender Personen zu identifizieren. Dabei haben wir uns auf verschiedene Beratungsstellen konzentriert, um unterschiedliche Perspektiven abzudecken. Wir sind im Akutkrankenhaus gewesen, haben uns betriebliche Beratungsstellen angeschaut, und mit Pflegediensten gesprochen. Diese Expert:inneninterviews waren unsere Grundlage, um Themenbereiche für die ersten Workshops zu identifizieren. Wir haben das Format des Literacy Promptathon so angepasst, dass wir mit Fallbeispielen an den Start gehen. Diese können von den Teilnehmenden genutzt werden oder sie nutzen die KI für ihre eigenen Fragen.
Der erste Workshop fand im Mai 2025 in Zusammenarbeit mit den Familienbüros verschiedener Hamburger Hochschulen statt. Weitere Workshops sind in Planung. Außerdem waren wir beim Tag der offenen Tür im Haus der Barrierefreiheit. Dort konnten Besucher:innen direkt an unserem Infostand die KI erproben. Auf iPads des eScience Büros nehmen wir alles auf, was auf den Bildschirmen während der Workshops passiert. In den Workshops arbeiten die Teilnehmenden in kleinen Gruppen zusammen. Diese Gespräche zeichnen wir ebenso auf. Für uns ist es spannend zu schauen, wie die Idee für einen neuen Prompt entsteht.
Wie sahen die Begegnungen mit den Teilnehmenden des ersten Workshops aus?
Viele Teilnehmende hatten das Gefühl, dass die KI irgendwann anfängt, sich im Kreis zu drehen: Die Antworten änderten sich ab einem gewissen Punkt nicht. Es bestand zwar der Eindruck, dass da noch Informationen sind, aber die eigenen KI-Kenntnisse nicht weit genug reichen, um an die gewünschten Inhalte zu kommen. Trotzdem waren sich alle einig, dass sich die generative KI für eine erste Information ganz gut eignet.
Eine weitere Beobachtung der Teilnehmenden, auf die wir aber im Vorfeld aufmerksam gemacht haben, ist, dass nicht immer alles stimmt, was eine KI so sagt. Die generierten Antworten werden von der KI nicht unbedingt mit Suchmaschineninhalten abgeglichen. Das kommt ganz auf das genutzte KI-Tool an. Einige Tools erfüllen diese Funktion. Im Workshop kam es teilweise dazu, dass die Ergebnisse nicht auf aktuellen Werten oder Aussagen basierten. Da müsste also an einer Stelle der Hinweis kommen, sich mit diesem Thema an eine Beratungsstelle zu wenden.
Genau darin sehen wir auch unsere Aufgabe im Projekt: Wir wollen aus den Erkenntnissen der Workshops und Interviews Empfehlungen ableiten, wie man KI für die Beratung im Bereich der Pflege nutzen kann. Diese Hinweise wollen wir der Praxis zur Verfügung stellen. Beratungsstellen müssen dafür sensibilisiert werden, dass Ratsuchende sich mittels generativer KI informieren. Dann können sie den Ratsuchenden beispielsweise auf ihrer Webseite Bausteine an die Hand geben, wie diese die KI gut nutzen können. Damit schaffen sie auch eine Grundlage, um in Beratungsgesprächen darauf aufzubauen.
Gibt es auch Sorgen um mögliche Risiken oder Nachteile, die sich bei der Verwendung von KI im Bereich der Pflegeberatung abzeichnen?
Fehlinformationen sind ein großes Thema. Ein weiteres ist die Verwendung personenbezogener Daten – etwa zum Zweck personalisierter Werbung. Die KI ist eine Blackbox, das heißt, es geht was rein und es kommt was raus. Was dazwischen passiert, ist unklar. Alles, was ich in einen Chat eingebe, wird zur Verbesserung der KI genutzt. Das heißt aber auch, dass meine Eingaben bei jemand anderem als Ergebnis herauskommen können. Gleichzeitig können KI-Anbieter gesammelte Daten theoretisch an Dritte weiterverkaufen. Das kann ich zwar verweigern, aber eine Verweigerung der Datennutzung muss immer aktiv geschehen. Das heißt, ich muss in die Einstellungen gehen und suchen, wo ich der Nutzung meiner Daten zu KI-Trainings- oder Werbezwecken widersprechen kann. Aber auch dann habe ich keine volle Transparenz darüber, was mit meinen Daten geschieht. In unseren Workshops geben wir daher immer den Hinweis, keine persönlichen Daten zu verwenden. Also nicht den eigenen Namen, Adresse, oder den eigenen Beruf nennen. Stattdessen sollte ich mir Synonyme überlegen oder mit Fallbeispielen arbeiten.
KI ist aktuell in aller Munde. Was glauben Sie ganz persönlich: Welche Rolle wird KI zukünftig in der Erwachsenenbildung allgemein spielen?
Eine ähnliche Frage habe ich letztes Jahr schon einmal gestellt bekommen. Dort war meine Prognose, dass es noch circa ein Jahr dauern würde, bis Menschen mit geringer Literalität generative KI kostenfrei auf ihren Smartphones überall zur Verfügung steht. Meta hat diesen Zeitraum unterboten, indem sie generative KI im April für WhatsApp serienmäßig eingeführt haben. Daher wird es auch zukünftig Aufgabe der Erwachsenenbildung sein, in dem Bereich auch über die Risiken aufzuklären. Es muss weiterhin dafür sensibilisiert werden, dass nicht alles stimmt, was da rauskommt und dass KI gleichzeitig die Generierung von Fake-Inhalten unterstützt. Eine Aufgabe wird es sein, Menschen im kritischen prompten zu schulen. Es ist wichtig, sich nicht mit der ersten Antwort zufriedenzugeben, sondern Antworten zu hinterfragen oder über die Antwort mit der KI in einen Dialog einzutreten.
Mit Blick auf die Forschung ergibt sich noch eine andere Herausforderung: Die Fortschritte der generativen KI sind groß. Mit jedem Update und jedem neuen Anwendungsbereich muss man seine Forschung ein Stück weit infrage stellen. Wenn ich zum Beispiel meine Daten mit Chat GPT 3.5 erhoben habe, jetzt aber schon eine ganz neue Version verfügbar ist, muss ich prüfen, ob meine Ergebnisse noch relevant sind. Viele Forschungsprojekte zu KI sind noch nicht sichtbar, weil viele Publikationen noch im Review oder im Publikationsprozess stecken. Sowohl in der Erwachsenenbildung als auch in der Forschung wird uns das Thema also noch eine Weile beschäftigen.
Was ist ein Prompt-a-thon?
In Anlehnung an den Begriff Hackathon ist „Prompt-a-thon“ eine Wortneuschöpfung aus den Begriffen „prompten“, also Eingaben in eine künstliche Intelligenz, und Marathon. Promt-a-thons sind Veranstaltungen, bei denen Teilnehmende Prompts für generative KI-Systeme entwickeln und optimieren. In Gruppen werden kollaborativ Prompts generiert, um unterschiedlichen Aufgaben von der KI lösen zu lassen und dabei ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Entwickelt wurde die Idee des „Prompt-A-Thon“ von Prof. Dr. Tilo Böhmann, Vizepräsident der Universität Hamburg und Leiter der Forschungsgruppe IT-Management und Consulting. Der Begriff „Prompt-A-Thon“ ist mittlerweile markenrechtlich geschützt.